Mein Ziel ist es, in diesem Essay die Frage »Gibt es so etwas wie Geisteskrankheit?« aufzuwerfen und darzulegen, weshalb es sie nicht gibt.
Da der Begriff »Geisteskrankheit« heutzutage äußerst häufig benutzt wird, scheint eine Untersuchung der Formen seiner Verwendung besonders angezeigt zu sein. Selbstverständlich handelt es sich bei Geisteskrankheit nicht um ein »Ding« oder physisches Objekt im buchstäblichen Sinne und kann deshalb auch nur in derselben Art und Weise »existieren«, wie andere theoretische Konstrukte existieren. Jedoch erscheinen allgemein bekannte Theorien – zumindest denjenigen, die an sie glauben – mit der Zeit als »objektive Wahrheiten« oder »Tatsachen«. Im Verlauf bestimmter geschichtlicher Perioden traten erklärende Konzepte wie Gottheiten, Hexen und Mikroorganismen nicht nur als Theorien in Erscheinung, sondern wurden auch als selbstevidente Ursachen für eine große Anzahl von Ereignissen angesehen. Ich behaupte, dass heutzutage Geisteskrankheit in ähnlicher Weise als Ursache für unzählige verschiedenartige Ereignisse angesehen wird. Als Mittel gegen den unkritischen Gebrauch des Begriffes Geisteskrankheit – ob nun als selbstevidentes Phänomen, als Theorie oder als Ursache – lassen Sie uns fragen: »Was ist gemeint, wenn behauptet wird, jemand sei geisteskrank?«
Im Folgenden werde ich kurz die Hauptanwendungsgebiete des Begriffes Geisteskrankheit beschreiben. Ich werde die Auffassung vertreten, dass dieser Begriff seine möglicherweise einmal vorhandene Nützlichkeit verloren hat und heute nur noch als zweckmäßiger Mythos dient.
Der Begriff Geisteskrankheit leitet sich hauptsächlich von solchen Phänomenen wie Hirnsyphilis oder deliranten Zuständen – z.B. Vergiftungen – ab, bei denen Personen verschiedene Eigentümlichkeiten oder Störungen des Denkens und Verhaltens zeigen. Genau genommen sind dies jedoch Erkrankungen des Gehirns und nicht des Geistes.
Einer bestimmten Denkschule zufolge, gehören alle sogenannten Geisteskrankheiten zu dieser Kategorie. Man nimmt dabei an, dass man letztlich einen – vielleicht kaum wahrnehmbaren – neurologischen Defekt finden würde, der für all diese Störungen des Denkens verantwortlich ist. Viele Psychiater, Ärzte und andere Wissenschaftler vertreten heute diese Ansicht. Diese Position setzt stillschweigend voraus, dass Menschen Schwierigkeiten – im Sinne dessen, was heute als »Geisteskrankheiten« bezeichnet wird – überhaupt nicht aufgrund der Unterschiede ihrer persönlicher Bedürfnisse, sozialen Bestrebungen, Werte usw. haben können. Alle Probleme des Lebens werden physikochemischen Prozessen zugeordnet, die früher oder später durch die medizinische Forschung aufgedeckt würden.
»Geisteskrankheiten« werden folglich als grundsätzlich gleichwertig zu allen anderen Krankheiten (d.h. Krankheiten des Körpers) betrachtet. Aus dieser Perspektive ist der einzige Unterschied zwischen psychischen und körperlichen Erkrankungen der, dass erstere das Gehirn befallen und sich durch psychische Symptome manifestieren, wohingegen letztere andere Organsysteme (z.B. Haut, Leber usw.) befallen und sich dabei durch Symptome äußern, die mit den betroffenen Bereichen des Körpers in Zusammenhang gebracht werden können. Diese Ansicht beruht meines Erachtens auf zwei fundamentalen Irrtümern.
Erstens: Welche Symptome des zentralen Nervensystems wären mit Hautausschlag oder einem Knochenbruch vergleichbar? Auf jeden Fall wären es nicht ein Gefühl oder komplexeres Verhalten. Schon eher wären es Blindheit oder die Lähmung eines Körperteils. Der entscheidende Punkt ist, dass es sich bei einer Erkrankung des Gehirns – analog zur Erkrankung der Haut oder der Knochen – um einen neurologischer Defekt und nicht um ein Lebensproblem handelt. Zum Beispiel kann ein Defekt im Sehfeld einer Person hinreichend erklärt werden, in dem man ihn mit bestimmten begrenzten Verletzungen des Nervensystems in Beziehung setzt.
Auf der anderen Seite kann der Glaube eines Menschen – sei es der Glaube an das Christentum, an den Kommunismus oder an die Vorstellung, dass seine inneren Organe »verfaulten« und dass sein Körper in Wirklichkeit schon »tot« sei – niemals durch einen Defekt oder eine Erkrankung des Nervensystems erklärt werden. Erklärungen für diese Art von Erscheinungen müssen in einer anderen Richtung gesucht werden, vorausgesetzt, man ist an dem Glauben selbst interessiert und betrachtet ihn nicht einfach nur als »Symptom« oder Ausdruck von etwas anderem, das interessanter ist.
Der zweite Irrtum ist ein epistemologischer, wenn komplexes psychosoziales Verhalten, das Mitteilungen über uns selbst und über die uns umgebende Welt enthält, als bloßes Symptom neurologischer Aktivität gedeutet wird. Anders gesagt, es handelt sich nicht um Beobachtungsfehler oder falsche Schlussfolgerungen, sondern um die Art und Weise, wie wir unser Wissen organisieren und ihm Ausdruck verleihen.
In unserem Fall liegt der Irrtum in der Schaffung eines symmetrischen Dualismus zwischen psychischen und physischen bzw. körperlichen Symptomen. Ein Dualismus, der nur eine Sprachgewohnheit ist und dem keine bekannten Beobachtungen zugeordnet werden können. Wir wollen sehen, ob dem tatsächlich so ist.
Wenn wir in der medizinischen Praxis von physischen Störungen sprechen, dann meinen wir entweder Zeichen (z.B. Fieber) oder Symptome (z.B. Schmerz). Auf der anderen Seite sprechen wir von psychischen Symptomen, wenn wir uns auf die Mitteilungen des Patienten über sich selbst, über andere und die ihn umgebende Welt beziehen. Er könnte beispielsweise behaupten, dass er Napoleon sei oder dass er von den Kommunisten verfolgt werde. Diese Behauptungen würden nur dann als psychische Symptome angesehen werden, wenn der Beobachter glauben würde, dass der Patient nicht Napoleon ist oder dass er nicht von den Kommunisten verfolgt [sic] wird. Damit wird offensichtlich, dass die Aussage, »X ist ein psychisches Symptom« gleichzeitig die Verkündung eines Urteils ist.
Darüberhinaus beinhaltet das Urteil versteckt einen Vergleich bzw. eine Gegenüberstellung der Ideen, Begriffe oder Überzeugungen des Patienten und denen des Beobachters und der Gesellschaft, in der beide leben. Der Begriff des psychischen Symptoms ist deshalb ähnlich untrennbar verbunden mit dem sozialen (einschließlich ethischen) Kontext, in dem er gebildet wird, wie auch der Begriff des körperlichen Symptoms an einen anatomischen und genetischen Kontext (Szasz, 1957a, 1957b) gebunden ist.
Zusammengefasst: Ich habe versucht zu zeigen, dass für diejenigen, die psychische Symptome als Zeichen einer Hirnerkrankung ansehen, der Begriff der Geisteskrankheit unnötig und irreführend ist. Denn was sie meinen ist, dass auf diese Art etikettierte Menschen an einer Erkrankung des Gehirns leiden. Und wenn es tatsächlich das ist, was sie meinen, dann wäre es um der Klarheit willen besser, genau dies zu sagen und nichts anderes.
Der Ausdruck »Geisteskrankheit« wird häufig für die Beschreibung von etwas benutzt, das sich erheblich von einer Erkrankung des Gehirns unterscheidet. Viele Menschen halten es heute für selbstverständlich, dass das Leben ein mühevoller Prozess ist. Seine Härte für den modernen Menschen ist zudem weniger dem Kampf um das biologische Überleben geschuldet, als vielmehr den Belastungen, die das soziale Miteinander komplexer Persönlichkeiten mit sich bringt. In diesem Kontext wird der Begriff der Geisteskrankheit benutzt, um einige Merkmale der sogenannten Persönlichkeit eines Individuums zu identifizieren oder zu beschreiben.
Dabei wird Geisteskrankheit, sozusagen als eine Deformation der Persönlichkeit, als die Ursache der menschlichen Disharmonie angesehen. Implizit in dieser Sichtweise enthalten ist die Vorstellung, das menschliche Zusammenleben sei von Natur aus harmonisch und Störungen dieser Harmonie seien deshalb auf die Anwesenheit von »Geisteskrankheiten« bei vielen Menschen zurückzuführen. Das ist offensichtlich eine irreführende Argumentation, da sie aus der Abstraktion »Geisteskrankheit« eine Ursache macht, obwohl diese Abstraktion ursprünglich nur als sprachliche Abkürzung zur Bezeichnung bestimmter menschlicher Verhaltensweisen diente.
An dieser Stelle drängt sich die Frage auf: »Welche Verhaltensweisen werden als Anzeichen für eine Geisteskrankheit angesehen und durch wen?«
Der Begriff der Krankheit, ob körperliche oder geistige, impliziert eine Abweichung von einer klar definierten Norm. Im Fall der physischen Krankheit ist die Norm die strukturelle und funktionelle Integrität des menschlichen Körpers. So kann das, was Gesundheit ist, in anatomischen und physiologischen Begriffen ausgedrückt werden, unbeachtet der Tatsache, dass die Erwünschtheit physischer Gesundheit einen ethischen Wert darstellt.
Von welcher Norm aber wird abgewichen, wenn von Geisteskrankheit die Rede ist? Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten. Aber welche Norm es auch immer sein mag, eines kann mit Sicherheit gesagt werden: dass es sich um eine Norm handelt, die in psychosozialen, ethischen und rechtlichen Begriffen ausgedrückt werden muss.
Begriffe wie »übermäßige Unterdrückung« oder »einen unbewussten Impuls ausagieren« zeigen beispielsweise, wie psychologische Modelle für die Beurteilung (sogenannter) psychischer Gesundheit und Krankheit benutzt werden. Die Auffassung, dass chronische Feindseligkeit, Rachsucht oder Ehescheidung auf eine Geisteskrankheit hinweisen, ist ein Beispiel für den Gebrauch ethischer Normen (hier die Erwünschtheit von Liebe, Freundlichkeit und stabilen ehelichen Beziehungen).
Schließlich ist die unter Psychiatern weit verbreitete Meinung, nur eine geisteskranke Person könne einen Mord begehen, ein Beispiel dafür, wie ein Rechtsbegriff zu einer Norm für geistige Gesundheit wird. Es ist immer die Abweichung von einer psychosozialen und ethischen Norm gemeint, wenn von Geisteskrankheit die Rede ist. Dennoch versucht man, ihr mit Hilfe medizinischer Mittel zu begegnen, von denen man annimmt, sie seien frei von großen ethischen Wertunterschieden. Die Definition der Störung und die Begriffe für ihre Behebung sind deshalb schwerlich miteinander vereinbar. Die praktische Bedeutung dieses verdeckten Konflikts zwischen der angeblichen Natur des Defekts und seiner Behebung kann kaum überbetont werden.
Da wir nun die Normen identifiziert haben, anhand derer Abweichungen im Fall von Geisteskrankheit ermittelt werden, kehren wir nun zurück zu der Frage: »Wer definiert die Normen und damit die Abweichung?« Zwei grundlegende Antworten bieten sich hier an: (a) Es kann die Person selbst (d.h. der Patient) sein, der entscheidet, dass er von einer Norm abweicht. Zum Beispiel kann ein Künstler glauben, er leide an einer Arbeitshemmung und er kann daraufhin bei einem Psychotherapeuten um Hilfe für sich selbst suchen. (b) Es kann jemand anders als der Patient sein (z.B. Verwandte, Ärzte, Behörden, die Gesellschaft usw.), der entscheidet, dass letzterer von einer Norm abweicht. In einem solchen Fall könnte ein Psychiater von anderen beauftragt werden, mit dem Patienten etwas zu machen, um die Abweichung zu korrigieren.
Diese Überlegungen unterstreichen, von welch großer Bedeutung es ist, die Frage: »In wessen Auftrag handelt der Psychiater?« zu stellen und sie ehrlich zu beantworten (Szasz 1956, 1958). Der Psychiater (Psychologe oder nichtmedizinischer Psychotherapeut), so hat sich gezeigt, kann im Auftrag des Patienten, der Verwandten, der Schule, des Militärs, eines Unternehmens, eines Gerichts usw. handeln. Als Beauftragter dieser Personen oder Organisationen müssen die moralischen Wertbegriffe des Psychiaters oder seine Vorstellungen hinsichtlich einer geeigneten Heilbehandlung nicht notwendigerweise mit denen seines Auftraggebers übereinstimmen.
Zum Beispiel könnte ein Patient in einer Einzeltherapie glauben, dass für ihn die Rettung in einer neuen Heirat liege. Sein Psychotherapeut muss diese Hypothese nicht teilen, als Beauftragter des Patienten darf er jedoch keine sozialen oder juristischen Druckmittel anwenden, um den Patienten davon abzubringen, seine Absichten in die Tat umzusetzen. Wenn ein Vertrag mit dem Patienten abgeschlossen wurde, dann kann der Psychiater (Psychotherapeut) ihm widersprechen oder die Behandlung abbrechen, er kann aber nicht Außenstehende hinzuziehen, um den Patienten an der Verfolgung seiner Ziele zu hindern.
Genauso muss ein von einem Gericht beauftragter Psychiater die Zurechnungsfähigkeit eines Kriminellen zu untersuchen, nicht vollständig die Werte und Absichten der Justizbehörden bezüglich des Kriminellen und der gegen ihn eingesetzten Mittel befürworten. Dem Psychiater ist es allerdings ausdrücklich untersagt, beispielsweise festzustellen, dass nicht der Kriminelle »verrückt« ist, sondern der Mann der das Gesetz schrieb, auf dessen Basis die beurteilten Handlungen als »kriminell« eingestuft werden. Solch eine Meinung dürfte zwar geäußert werden, aber nicht im Gerichtssaal und nicht durch einen Psychiater, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Gericht bei seiner täglichen Arbeit zu unterstützen.
Ich wiederhole: In der heutigen sozialen Praxis definiert sich Geisteskrankheit durch eine Abweichung des Verhaltens von bestimmten sozialen, ethischen oder rechtlichen Normen. Die Beurteilung kann wie in der Medizin durch den Patienten, den Arzt (Psychiater) oder andere vorgenommen werden. Für die Heilbehandlung wird schließlich üblicherweise ein therapeutischer – oder verdeckt medizinischer – Rahmen als geeignet angesehen und damit eine Situation geschaffen, in der psychosoziale, ethische und/oder rechtliche Abweichungen als durch (sogenannte) medizinische Maßnahmen korrigierbar erscheinen. Da medizinische Maßnahmen dazu geschaffen sind, nur medizinische Abweichungen zu korrigieren, erscheint es logisch absurd, zu erwarten, dass sie auch zur Lösung von Problemen dienen können, die auf einer nichtmedizinischen Grundlage definiert und festgestellt wurden.
Ich denke, dass diese Überlegungen sehr gut auch auf den heutigen Gebrauch von Tranquilizern und in einem weiteren Sinne auch auf das, was von Drogen (welcher Art auch immer) hinsichtlich der Verringerung oder Lösung von Problemen des Lebens erwartet wird, angewendet werden können.
Alles, was Menschen tun – im Gegensatz zu dem, was ihnen widerfährt (Peters 1958) – findet in einem Wertekontext statt. In diesem umfassenden Sinn ist keine menschliche Handlung frei von ethischen Implikationen. Wenn die Werte, die bestimmten Handlungen zugrunde liegen, Allgemeingut sind, dann kann es geschehen, dass den Handelnden diese Werte irgendwann nicht mehr bewusst sind.
Medizin als reine Wissenschaft (z.B. Forschung) und als Technologie (z.B. Therapie), beinhaltet viele ethische Überlegungen und Urteile. Unglücklicherweise wird dies oft geleugnet, verharmlost oder einfach nicht beachtet, denn als Ideal begriffen ist sowohl der medizinischen Profession als auch den Menschen, denen sie dient, an einem Gesundheitssystem gelegen, das (angeblich) frei von ethischen Werten ist. Diese sentimentale Vorstellung drückt sich beispielsweise in der ärztlichen Bereitschaft aus, Patienten unabhängig davon, welche politischen oder religiösen Überzeugungen sie haben, ob sie arm oder reich sind usw., zu behandeln und ihnen zu helfen. Auch wenn es Gründe für den Glauben an eine wertfreie Medizin geben mag (obwohl diese Auffassung selbst hinsichtlich des genannten Beispiels nicht besonders zutreffend ist), so sollte uns das nicht von der Tatsache ablenken, dass menschliche Angelegenheiten von einer Vielzahl ethischer Überlegungen begleitet werden. Die medizinische Praxis kann zwar hinsichtlich bestimmter ethischer Fragen einen neutralen Standpunkt einnehmen, dies bedeutet aber nicht und kann auch nicht bedeuten, dass sie vollständig wertfrei sein könnte. Im Gegenteil: die medizinische Praxis ist auf das Engste mit ethischen Fragen verbunden. Dies klar und deutlich zum Ausdruck zu bringen, scheint mir unsere wichtigste Aufgabe zu sein.
Ich werde das Thema an dieser Stelle auf sich beruhen lassen, da es uns in diesem Essay nicht weiter zu interessieren braucht. Damit aber keine Missverständnisse darüber aufkommen, wie oder wo Ethik und Medizin sich treffen, möchte ich den Leser an Probleme wie Geburtenkontrolle, Abtreibung, Selbstmord und Euthanasie als einige wenige Beispiele für gegenwärtige medizinethische Kontroversen erinnern.
Ich behaupte, dass die Psychiatrie in noch viel stärkerem Maße als die Medizin mit ethischen Problemen verknüpft ist. Ich benutze das Wort »Psychiatrie« für die heutige Disziplin, die sich mit Lebensproblemen befasst (und nicht mit Erkrankungen des Gehirns, die zum Arbeitsfeld der Neurologie gehören). Probleme in menschlichen Beziehungen können nur innerhalb eines sozialen oder ethischen Kontextes analysiert, interpretiert und mit einer Bedeutung versehen werden. Entsprechend spielen die sozialethischen Orientierungen des Psychiaters – trotz gegenteiliger Behauptungen – durchaus eine Rolle, weil sie seine Vorstellungen darüber beeinflussen, was mit dem Patienten nicht in Ordnung ist, was einen Kommentar oder eine Interpretation erfordert, in welche Richtungen sich der Patient entwickeln sollte usw. Sogar in der echten Medizin spielen diese Faktoren eine Rolle, wenn beispielsweise Ärzte abhängig von ihren religiösen Überzeugungen unterschiedliche Ansichten zu Fragen wie Geburtenkontrolle und therapeutische Abtreibung vertreten. Kann jemand ernsthaft glauben, dass die Ansichten eines Psychotherapeuten über religiösen Glauben, Sklaverei oder ähnliche Fragen keine Rolle für seine praktische Arbeit spielen? Wenn sie aber tatsächlich eine Rolle spielen, was folgt daraus? Scheint es nicht vernünftig, verschiedene psychiatrische Therapien zu haben, die sich jeweils ausdrücklich über die in ihnen enthaltenen ethischen Positionen definieren; das heißt, für Katholiken und Juden, religiöse Personen und Agnostiker, für Demokraten und Kommunisten, weiße Rassisten und Schwarze usw. jeweils eine eigene Therapie? Und in der Tat, wenn man sich heute die psychiatrische Praxis (vor allem in den Vereinigten Staaten) anschaut, dann kann man sehen, dass sozialer Status und ethische Überzeugungen darüber entscheiden, welche Form psychiatrischer Hilfe gewählt wird (Hollingshead & Redlich, 1958). Das sollte uns wirklich nicht mehr überraschen als die Feststellung, dass praktizierende Katholiken nur sehr selten Abtreibungskliniken aufsuchen.
Meine Position, dass heutige Psychotherapeuten sich mit Lebensproblemen befassen und nicht etwa mit Geisteskrankheiten und deren Heilung, steht im Gegensatz zur vorherrschenden Auffassung, Geisteskrankheiten seien genauso »real« und »objektiv« wie wie körperliche Erkrankungen. Diese Behauptung ist irreführend, da niemand wirklich weiß, was mit solchen Worten wie »real«und »objektiv« gemeint ist. Ich vermute jedoch, dass es von den Verfechtern dieser Ansichten beabsichtigt ist, eine Vorstellung in der öffentlichen Meinung zu verankern, nach der Geisteskrankheiten zur gleichen Art von Erkrankungen gehören wie Infektionen oder ein Malignom. Wenn das wahr wäre, könnte man sich eine »Geisteskrankheit« holen oder sie bekommen, man könnte sie haben, man könnte sie auf andere übertragen und schließlich könnte man sie loswerden. Meiner Meinung nach gibt es nicht den Deut eines Beweises für diese Auffassung. Im Gegenteil: alle Befunde weisen in die entgegengesetzte Richtung und stützen die Ansicht, dass das, was man heute als Geisteskrankheit bezeichnet, zum größten Teil Kommunikationen sind, die unakzeptable Ansichten ausdrücken und dies häufig in einer ungewöhnlichen Form. Im Rahmen dieses Essays kann ich auf diesen alternativen theoretischen Ansatz lediglich hinweisen (Szasz 1957c).
Hier ist nicht der Ort, um im Detail auf die Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen körperlichen und geistigen Krankheiten einzugehen. Es soll uns hier genügen, nur einen der wesentlichen Unterschiede zwischen beiden herauszustellen: Dass sich nämlich körperliche Krankheiten auf öffentlich beobachtbare physikochemische Erscheinungen beziehen, der Begriff der Geisteskrankheit dagegen auf ein relativ privates sozialpsychologisches Geschehen, zu dessen Bestandteilen der Beobachter bzw. Diagnostiker selbst gehört.
Mit anderen Worten: der Psychiater steht nicht abseits von dem, was er beobachtet, sondern ist – was Harry Stack Sullivan mit treffenden Worten beschreibt – ein »teilnehmender Beobachter«. Das bedeutet, dass der Psychiater an eine gewisse Realitätsvorstellung gebunden ist und daran, was in seinen Augen die Gesellschaft als Realität auffasst. Und es bedeutet, dass er das Verhalten des Patienten im Lichte dieser Vorstellungen beobachtet und beurteilt. Dies schließt an unsere Beobachtung an, dass der Begriff des psychischen Symptoms bereits einen Vergleich zwischen Beobachter und Beobachteten bzw. Psychiater und Patient enthält. Das ist so offensichtlich, dass man mir vorwerfen könnte, ich langweilte mit Trivialitäten. Lassen Sie mich deshalb noch einmal sagen, dass ich mit meinem Argument ausdrücklich die vorherrschende Tendenz kritisieren und ihr widersprechen will, welche die moralischen Aspekte von Psychiatrie und Psychotherapie leugnet und an ihre Stelle angeblich wertfreie medizinische Überlegungen setzt. Psychotherapie wird beispielsweise häufig so praktiziert, als ob es um nichts anderes ginge, als den Patienten von einem Zustand der geistigen Krankheit in einen der geistigen Gesundheit zurückzuführen. Während allgemein anerkannt wird, dass Geisteskrankheit etwas mit den sozialen oder interpersonalen Beziehungen der Menschen zu tun hat, wird paradoxerweise gleichzeitig daran festgehalten, dass ethische Probleme in diesem Prozess keine Rolle spielen würden.[1]
Dennoch dreht sich in der Psychotherapie gewissermaßen vieles einzig um die Herausarbeitung und Abwägung von Zielen und Werten, von denen sich viele gegenseitig widersprechen, und um die Mittel, mit denen sie am besten in Einklang gebracht, verwirklicht oder aufgegeben werden können. Die Bandbreite menschlicher Wertvorstellungen und Methoden, mit denen diese verwirklicht werden können, sind so vielfältig und bleiben so oft den Handelnden verborgen, dass sie zwangsläufig zu Konflikten in den menschlichen Beziehungen führen müssen. Zu sagen, dass menschliche Beziehungen auf allen Ebenen – von Mutter und Kind über Ehemann und Ehefrau bis zu Nation und Nation – mit Stress, Spannungen und Disharmonie belastet sind, hieße nur, das Offenkundige auszusprechen. Dennoch kann, was offenkundig ist, gleichzeitig kaum verstanden sein. Ich denke, dass dies hier der Fall ist, denn es scheint mir, dass wir es bisher – zumindest in unseren wissenschaftlichen Theorien vom menschlichen Verhalten – unterlassen haben, die schlichte Tatsache zu akzeptieren, dass menschliche Beziehungen von Natur aus mit Schwierigkeiten belastet sind und es viel Geduld und harte Arbeit erfordert, sie auch nur annähernd harmonisch zu gestalten.
Ich behaupte, dass die Idee von einer Geisteskrankheit heute dazu eingesetzt wird, bestimmte Schwierigkeiten im menschlichen Miteinander zu verbergen, ohne damit sagen zu wollen, dass sie nicht veränderbar wären. Wenn das wahr ist, dann dient das Modell als Tarnung. Statt die Aufmerksamkeit auf miteinander in Konflikt stehende menschliche Bedürfnisse, Bestrebungen und Werte zu lenken, liefert der Begriff der Geisteskrankheit ein amoralisches und unpersönliches »Ding« (eine »Krankheit«) als Erklärung für Lebensprobleme (Szasz 1959). Wir sollten uns in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass es vor noch gar nicht so langer Zeit Teufel und Hexen waren, die für die Probleme im Zusammenleben der Menschen verantwortlich gemacht wurden. Der Glaube an Geisteskrankheiten, verstanden als etwas anderes als die Schwierigkeiten des Menschen, mit seinem Mitmenschen zurecht zu kommen, ist das wahre Erbe des Glaubens an Dämonologie und Hexerei. Geisteskrankheit existiert oder ist »real« in exakt dem gleichen Sinn, in dem Hexen existierten oder »real« waren.
Wenn ich behaupte, dass Geisteskrankheiten nicht existieren, so will ich damit nicht sagen, dass die sozialen und psychologischen Erscheinungen, die gegenwärtig mit diesem Etikett versehen werden, ebenfalls nicht existieren würden. Sie sind genauso real wie die persönlichen und sozialen Schwierigkeiten, denen Menschen im Mittelalter ausgesetzt waren. Mir geht es um die Etikette, die wir Lebensproblemen anheften und darum, wie wir mit ihnen umgehen, nachdem wir sie etikettiert haben. Obwohl ich an dieser Stelle die verzweigten Implikationen dieses Problems nicht vertiefen kann, möchte ich doch darauf hinweisen, dass einst eine dämonologische Konzeption von Lebensproblemen zur Entwicklung einer Therapie nach theologischen Richtlinien führte. Heute impliziert, nein: erfordert der Glaube an Geisteskrankheiten eine Therapie nach medizinischen oder psychotherapeutischen Richtlinien.
Der Gedankengang, der hier fortgesetzt werden soll, verfolgt ein gänzlich anderes Ziel: Ich will hier weder ein neues Konzept von »psychiatrischer Krankheit« noch eine neue Form von »Therapie« vorstellen. Mein Vorhaben ist bescheidener und gleichzeitig anspruchsvoller. Ich schlage vor, die Phänomene, die heute als Geisteskrankheiten bezeichnet werden, einer neuerlichen und einfacheren Betrachtung zu unterziehen, sie aus der Kategorie Krankheit zu entfernen und sie als Ausdruck des Ringens des Menschen mit dem Problem, wie er leben sollte zu verstehen. Das zuletzt erwähnte Problem ist offensichtlich ein sehr großes. Sein Ausmaß zeigt nicht nur die Unfähigkeit des Menschen, mit seiner Umwelt zurechtzukommen, sondern es verweist sogar noch mehr auf seine gestiegene Selbstreflektiertheit. Mit Lebensproblemen meine ich also die wahrhaft explosionsartige Kettenreaktion, die mit dem Verlust der göttlichen Gnade durch den Genuss der Frucht vom Baum der Erkenntnis ihren Anfang nahm. Das Bewusstsein des Menschen über sich selbst und seine Umwelt scheint stetig anzuwachsen, es führt aber in seinem Kielwasser eine immer größer werdende Last des Verstehens (ein von Susanne Langer geliehener Ausdruck, 1953) mit sich. Mit dieser Last muss also gerechnet und sie darf nicht falsch gedeutet werden. Unsere einzigen rationalen Mittel, uns die Last zu erleichtern, sind größeres Verständnis sowie angemessene Handlungen, die diesem Verständnis gerecht werden.
Die wesentlichste Alternative dazu besteht darin, so zu tun, als sei diese Last nicht das, was wir von ihr wahrnehmen, und uns stattdessen in eine überholte theologische Vorstellung vom Menschen zu flüchten. In dieser Vorstellung ist es nicht der Mensch selbst, der sein Leben und seine Umwelt gestaltet, sondern er folgt einzig seinem Schicksal in einer Welt, die von höheren Wesen geschaffen wurde. Die logische Folge davon könnte sein, dass die scheinbar unergründlichen Probleme und Schwierigkeiten als Vorwand benutzt werden, um sich der Verantwortung für das eigene Leben zu entziehen. Falls der Mensch es unterlässt, individuell und kollektiv Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, so scheint es dennoch unwahrscheinlich, dass eine höhere Kraft oder ein höheres Wesen diese Aufgabe übernehmen und ihn der Last entledigen würde. Darüber hinaus ist jetzt kaum der richtige Moment in der Menschheitsgeschichte, die Verantwortung des Menschen für seine Handlungen zu verschleiern, indem man sie unter dem Mantel einer alles erklärenden Vorstellung von Geisteskrankheit verbirgt.
Ich habe zu zeigen versucht, dass der Begriff der Geisteskrankheit den Nutzen, den er einmal gehabt haben mag, überlebt hat und heute nur noch als Mythos fungiert. Als solcher ist er ein Nachfolger religiöser Mythen im Allgemeinen und des Glaubens an Hexerei im Besonderen. Diese Glaubenssysteme spielten die Rolle eines sozialen Tranquilizers, indem sie die Hoffnung bestärkten, dass bestimmte Probleme durch symbolisch-magische Ersatzhandlungen gemeistert werden könnten.
Der Begriff der Geisteskrankheit dient deshalb vorrangig der Verschleierung der alltäglichen Tatsache, dass das Leben für die meisten Menschen ein beständiger Kampf, nicht um das biologische Überleben, sondern um einen »Platz an der Sonne«, um »Seelenfrieden« oder irgendwelche anderen menschlichen Werte ist. Sind die Bedürfnisse zur Erhaltung seines Körpers (vielleicht auch seiner Gattung) mehr oder weniger befriedigt, dann stellt sich dem sich seiner selbst und seiner ihn umgebenden Welt bewussten Menschen die Frage: Was fange ich mit mir und meinem Leben an? Das Festhalten am Mythos der Geisteskrankheit erlaubt es Menschen, diesem Problem aus dem Weg zu gehen und stattdessen zu glauben, dass geistige Gesundheit, verstanden als die Abwesenheit von Geisteskrankheit, ihnen automatisch richtige und sichere Entscheidung in ihrer Lebensführung garantieren würde. Die Realität beweist allerdings das genaue Gegenteil: es sind die klugen Entscheidungen, die anderen – rückblickend – als Beweis für gute geistige Gesundheit gelten!
Der Mythos der Geisteskrankheit bestärkt uns darüberhinaus im Glauben an seine logische Folge: dass der Umgang der Menschen miteinander harmonisch, zufriedenstellend und die sichere Grundlage eines »guten Lebens« wäre, gäbe es da nicht die störenden Einflüsse von Geisteskrankheiten oder »Psychopathologie«. Das Potential eines universellen menschlichen Glücks, zumindest in dieser Form, scheint mir lediglich ein weiteres Beispiel für reines Wunschdenken zu sein. Ich glaube daran, dass menschliches Glück oder Zufriedenheit in einem bisher unvorstellbar großen Ausmaß – und nicht nur für einige wenige – möglich ist. Dieses Ziel kann jedoch nur erreicht werden, wenn viele Menschen – nicht nur einige wenige – bereit sind, sich ihren persönlichen, sozialen und ethischen Problemen zu stellen und sie anzupacken. Dies bedeutet, den Mut und die Integrität zu besitzen, auf Kriege an falschen Fronten zu verzichten und dabei nur Lösungen für Ersatzprobleme zu finden – z.B. sich einem Ehekonflikt zu stellen, statt gegen Magensäure und chronische Ermüdung anzukämpfen. Unsere Widersacher sind nicht Dämonen, Hexen, das Schicksal oder Geisteskrankheit. Wir haben keinen Feind, den wir bekämpfen, exorzieren oder durch »Heilung« vertreiben könnten. Was wir tatsächlich haben sind Lebensprobleme, seien sie biologischer, ökonomischer, politischer oder sozialspsychologischer Art.
In diesem Essay habe ich mich nur mit Problemen der letztgenannten Kategorie befasst und innerhalb dieser Gruppe hauptsächlich mit denen, die mit moralischen Wertvorstellungen in Verbindung stehen. Das Feld, das die moderne Psychiatrie für sich in Anspruch nimmt, ist unüberschaubar und es lag nicht in meiner Absicht, es vollständig zu erfassen. Mein Argument war begrenzt auf die Behauptung, dass Geisteskrankheit ein Mythos ist, dessen Funktion darin besteht, zu verhüllen und uns damit die bittere Pille der moralischen Konflikte in menschlichen Beziehungen zu versüßen.
Hollingshead, A. B. und Redclicb, F. C., 1958, Social class and mental illness, New York: Wiley.
Jones, E., 1957, The life and work of Sigmund Freud, Vol. III, New York: Basic Books.
Lancer, S. R., 1953, Philosophy in a new hey, New York: Mentor Books.
Peteres, R. S., 1958, The concept of motivation, London: Routledge & Kegan Paul.
Szasz, T. S., 1956, Malingering: »Diagnosis« or social condemnation?, AMA Arch Neurol. Psychiat., 76, 432-443.
Szasz, T. S., 1957a, Pain and pleasure: A study of bodily-feelings, New York: Basic Books.
Szasz, T. S., 1957a, The problem of psychiatric nosology: A contribution to a situational analysis of psychiatric operations, Amer. J. Psychiat, 114, 405-413.
Szasz, T. S., 1957c, On the theory of psychoanalytic treatment, Int. J. Psycho-Anal., 38, 166-182.
Szasz, T. S., 1958, Psychiatry, ethics and the criminal law, Columbia law Rev., 58, 183-198.
Szasz, T. S., 1959, Moral conflict and psychiatry, Yale Rev., im Druck.
Übersetzung: Jan Groth
Das Original dieses Textes mit dem Titel »The Myth of Mental Illness« erschien in American Psychologist, 1960, 15, 113-118. Die Übersetzung basiert auf einer Veröffentlichung des Originals im Rahmen der Sammlung Classics in the History of Psychology, herausgegeben von Christopher D. Green, http://psychclassics.yorku.ca/Szasz/myth.htm (abgerufen am 30.5.2010).
(abgerufen am 30.5.2010).
Freud ging so weit zu sagen: »Ich betrachte Moral als eine Selbstverständlichkeit. Genau genommen habe ich nie etwas Unredliches getan.« (Jones, 1957, S. 247). Dies zu sagen ist natürlich eine merkwürdige Sache für jemanden, der den Menschen als soziales Wesen so tiefgehend studiert hat wie Freud. Ich erwähne das nur um zu zeigen, wie der Begriff der »Krankheit« (im Falle der Psychoanalyse, »Psychopathologie« oder »Geisteskrankheit«) durch Freud – und durch die meisten seiner Nachfolger – als Mittel benutzt wurde, um bestimmte Formen menschlichen Verhaltens als in den Zuständigkeitsbereich der Medizin fallend und deshalb – per Dekret – außerhalb des Moralischen stehend zu klassifizieren!
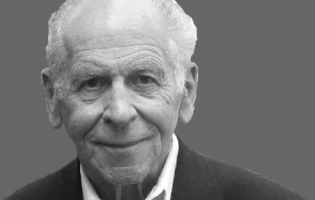

 Zum Anfang der Seite
Zum Anfang der Seite Druckversion
Druckversion PDF
PDF